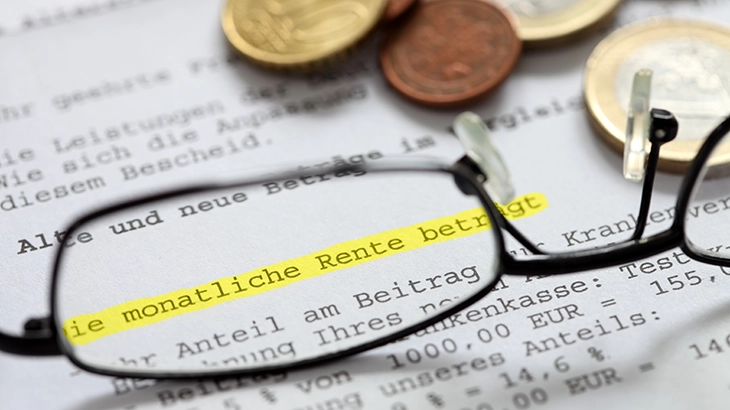
Rentenansprüche für pflegende Beschäftigte
Viele Beschäftigte in Deutschland leisten neben ihrer Arbeit oder anstelle einer Vollzeittätigkeit nicht erwerbsmäßige Pflege für Angehörige oder nahestehende Personen. Über 4,89 Millionen Menschen (Stand Dez. 2023, Quelle: Statistisches Bundesamt) werden zu Hause gepflegt, oft von Familienmitgliedern. Dieses Engagement ist enorm wichtig, kann aber zu Nachteilen bei der eigenen Rente führen, besonders wenn die Arbeitszeit reduziert oder die Berufstätigkeit ganz aufgegeben wird.
Die gute Nachricht: Unter bestimmten Voraussetzungen zahlt die Pflegekasse der gepflegten Person Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung für die Pflegenden. Das ist keine „Pflegerente“, sondern es sind reguläre Rentenbeiträge, die den späteren Rentenanspruch erhöhen oder überhaupt erst begründen können. Für Betriebs- und Personalräte ist es wichtig, diese Regelungen zu kennen, um Beschäftigte entsprechend informieren und unterstützen zu können.
Wer hat Anspruch auf Rentenbeiträge durch Pflege? Die Voraussetzungen im Überblick
Damit die Pflegekasse Rentenbeiträge für eine pflegende Person zahlt, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein (Stand: nach 1. Januar 2017; für frühere Zeiten galten teils andere Regeln):
Pflegebedürftigkeit:
Die gepflegte Person muss mindestens Pflegegrad 2 haben. (Pflege bei Pflegegrad 1 löst keinen Anspruch aus)
Art der Pflege:
Die Pflege muss als „nicht erwerbsmäßig“ (also ehrenamtlich) erfolgen. Das bedeutet, die Pflegeperson erhält keine Bezahlung für die Pflege. Eine Weiterleitung des Pflegegeldes von der pflegebedürftigen Person an die Pflegeperson ist jedoch erlaubt und gilt nicht als Erwerbsmäßigkeit. Denn in diesem Fall erhält die Pflegeperson das Geld nicht als Lohn für ihre Arbeit, sondern als Anerkennung und Unterstützung für ihre Pflegetätigkeit.
Umfang der Pflege:
Die Pflege muss für wenigstens zehn Stunden wöchentlich, verteilt auf regelmäßig mind. zwei Tage in der Woche, erfolgen. Werden mehrere Personen gepflegt (Additionspflege), können die Stunden addiert werden.
Ort der Pflege:
Die Pflege muss in der häuslichen Umgebung der pflegebedürftigen Person stattfinden.
Erwerbstätigkeit der Pflegeperson:
Die Pflegeperson darf neben der Pflege regelmäßig nicht mehr als 30 Stunden pro Woche erwerbstätig sein (gemäß § 3 Satz 3 SGB VI). Kurzfristige Überschreitungen sind unter Umständen möglich.
Wohnort der Pflegeperson:
Der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt muss in Deutschland, dem europäischen Wirtschaftsraum (EU, Norwegen, Island, Liechtenstein) oder der Schweiz liegen.
Dauer der Pflege:
Die Pflegetätigkeit muss voraussichtlich länger als zwei Monate oder 60 Tage im Jahr (nicht Kalenderjahr) ausgeübt werden. Kurzzeitige Vertretungen (z. B. Urlaubsvertretung) begründen keinen Anspruch.
Versicherung des Pflegebedürftigen:
Die pflegebedürftige Person muss Anspruch auf Leistungen aus der deutschen sozialen oder privaten Pflegeversicherung haben.
Keine Verwandtschaft nötig:
Die Pflegeperson muss nicht mit der gepflegten Person verwandt sein.
Wie die Pflegezeit auf die Rente angerechnet wird
Die Zeit, in der eine Pflegeperson die Pflege unter den genannten Voraussetzungen leistet, wird in der gesetzlichen Rentenversicherung als Beitragszeit gewertet und der sogenannten Wartezeit angerechnet (Mindestversicherungszeit für den Rentenanspruch).
Zusätzlich zahlt die Pflegekasse für die Pflegeperson Beiträge in die Rentenversicherung ein. Wie hoch diese Beiträge ausfallen und wie sich diese auf die Rente auswirken, hängt von verschiedenen Faktoren ab: dem zeitlichen Einsatz der Pflegeperson, dem Pflegegrad, dem Ort der Pflege (reine häusliche Pflege oder mit der Hilfe von professionellen Pflegekräften) und ob die Pflege von mehreren Pflegepersonen ausgeführt wird. In diesem Fall wird der Rentenbeitrag unter den Pflegenden aufgeteilt.
Durch die Pflegezeit können somit die Voraussetzungen für einen Rentenanspruch schneller erfüllt werden und auch die Höhe des späteren monatlichen Rentenanspruchs wird durch die zusätzlich gezahlten Beiträge erhöht.
Berechnung der Rentenbeiträge für Pflegepersonen
Die Höhe der Rentenbeiträge, die die Pflegekasse für nicht erwerbsmäßig pflegende Personen zahlt, ist von zwei Hauptfaktoren abhängig: dem Pflegegrad der zu pflegenden Person und der Art der bezogenen Pflegeleistung (Pflegegeld, Kombinationsleistung, Pflegesachleistungen). Generell gilt: Höhere Pflegegrade führen in der Regel zu höheren Rentenbeiträgen.
Konkret werden die Beiträge nicht direkt auf Basis des Pflegeaufwands berechnet, sondern auf Grundlage fiktiver Einnahmen, den sogenannten beitragspflichtigen Einnahmen. Diese fiktiven Einnahmen sind ein bestimmter Prozentsatz einer festgelegten Rechengröße in der Sozialversicherung, der sogenannten Bezugsgröße. Die Bezugsgröße orientiert sich am Durchschnittseinkommen aller Rentenversicherten in Deutschland und wird jährlich neu festgelegt. Bis Ende 2024 gab es hierfür unterschiedliche Werte für West- und Ostdeutschland; seit 2025 gilt ein einheitlicher Wert für ganz Deutschland.
Der genaue Prozentsatz der Bezugsgröße, der als beitragspflichtige Einnahme angesetzt wird, hängt vom Pflegegrad und der gewählten Leistungsart ab. Zum Beispiel wird bei Pflegegrad 5 und ausschließlichem Bezug von Pflegegeld ein höherer Prozentsatz der Bezugsgröße als beitragspflichtige Einnahme herangezogen als bei niedrigeren Pflegegraden oder anderen Leistungsarten wie der Kombinationsleistung (die eine Mischung aus Pflegegeld und Sachleistungen ist) oder reinen Pflegesachleistungen. Dadurch spiegeln sich der höhere Pflegebedarf und die damit oft verbundene höhere Beanspruchung der Pflegeperson indirekt in der Höhe der Beitragszahlung wider.
Die tatsächliche Höhe des Rentenbeitrags ergibt sich dann aus der Anwendung des aktuellen Rentenbeitragssatzes auf diese ermittelten beitragspflichtigen Einnahmen. Die Kosten für diese Rentenbeiträge trägt vollständig die jeweilige Pflegekasse. Aktuell liegen diese Rentenversicherungsbeiträge zwischen 131,65 und 696,57 Euro monatlich. Für ein Jahr Pflegetätigkeit kann ein monatlicher Rentenanspruch zwischen 6,61 und 34,99 Euro erworben werden. (Stand: April 2025; Quelle: www.bundesgesundheitsministerium.de)
Ausnahmen von den Rentenansprüchen
In bestimmten Konstellationen besteht kein Anspruch auf die Zahlung von Rentenversicherungsbeiträgen durch die Pflegekasse:
- Pflegepersonen unter 15 Jahren: Personen, die das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können keine rentenrechtlichen Zeiten durch Pflege erwerben.
- Kurzzeitige Pflegevertretung: Wird die Pflege lediglich vorübergehend übernommen, etwa als Urlaubsvertretung, und dauert die Pflege nicht länger als zwei Monate oder 60 Tage im Kalenderjahr, entsteht kein Anspruch.
- Pflege im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ), Bundesfreiwilligendienstes (BFD) oder einer Ordenszugehörigkeit: Diese Tätigkeiten begründen keinen Anspruch auf Rentenversicherungsbeiträge.
- Pflege von Personen mit Pflegegrad 1: Da Pflegegrad 1 keinen Rentenanspruch für Pflegepersonen auslöst, werden keine Beiträge entrichtet.
- Bezug einer vollen Altersrente oder Pension: Pflegepersonen, die eine volle Altersrente nach Erreichen der Regelaltersgrenze oder eine beamtenrechtliche Pension beziehen, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Ausnahme: Pflegepersonen, die eine Teilrente im Rahmen der Flexirente nach § 34 Abs. 2 SGB VI beziehen, können weiterhin Rentenansprüche erwerben.
- Pflegekräfte, die beruflich pflegen, erhalten die Beiträge nicht für ihre berufliche Tätigkeit. Sie können jedoch zusätzlich zu ihrem Beruf eine Person nicht erwerbsmäßig pflegen und unter den genannten Voraussetzungen Rentenbeiträge erhalten.
Unfallversicherung und Arbeitslosenversicherung
Pflegepersonen sind zudem beitragsfrei gesetzlich unfallversichert. Das gilt für Tätigkeiten, die auch in der Pflegeversicherung selbst als pflegerische Maßnahmen berücksichtigt werden sowie für die Hilfe bei der Haushaltsführung. Wenn die zu pflegenden Personen nicht im Haus der Pflegeperson wohnen, so ist der direkte Hin- und Rückweg zur Wohnung der Pflegebedürftigen ebenfalls unfallversichert.
Wer seine berufliche Tätigkeit zur Pflege aufgeben muss, dem zahlt die Pflegeversicherung die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung für die gesamte Dauer der Pflegetätigkeit. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass unmittelbar vor Beginn der Pflegetätigkeit eine Pflichtversicherung in der Arbeitslosenversicherung oder ein Anspruch auf eine laufende Entgeltersatzleistung nach SGB III vorlag. Somit verlieren Pflegepersonen ihren Versicherungsschutz nicht und haben nach dem Ende der Pflegetätigkeit – bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen – Anspruch auf Arbeitslosengeld und Leistungen der aktiven Arbeitsförderung, falls ein nahtloser Einstieg in eine Beschäftigung nach Ende der Pflegetätigkeit nicht gelingt. Das gilt auch für Personen, welche für die Pflege den Leistungsbezug aus der Arbeitslosenversicherung unterbrechen.
Sonderfälle
Teilen sich mehrere Personen die Pflege einer Person, muss jede Pflegeperson die Voraussetzungen individuell erfüllen, um den Anspruch zu erhalten.
Pflegt eine Pflegeperson mehrere Pflegebedürftige, können die Pflegezeiten addiert werden, um die Mindeststundenzahl zu erreichen.
Nimmt eine Pflegeperson Urlaub, werden die Rentenversicherungsbeiträge von der Pflegekasse für bis zu sechs Wochen im Kalenderjahr weitergezahlt.
Während der Elternzeit werden Zeiten der Pflege eines Angehörigen in der Rentenversicherung anerkannt, auch wenn Elterngeld bezogen wird. Die Deutsche Rentenversicherung schreibt für diese Zeiten Pflichtbeiträge gut, die dann den Rentenanspruch erhöhen.
Was müssen Beschäftigte tun, um die Rentenbeiträge zu erhalten?
- Pflegegrad beantragen: Falls noch nicht geschehen, muss für die pflegebedürftige Person bei deren Pflegekasse ein Pflegegrad beantragt werden. Der Medizinische Dienst (MD) prüft dann den Bedarf.
- Pflegekasse informieren: Sobald mindestens Pflegegrad 2 festgestellt wurde, muss die Pflegeperson der Pflegekasse mitteilen, dass sie die Pflege übernimmt.
- Fragebogen ausfüllen: Die Pflegekasse schickt der Pflegeperson in der Regel automatisch einen „Fragebogen zur Zahlung der Beiträge zur sozialen Sicherung für nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen“ zu. Hier werden Angaben zum Umfang der Pflege, zur Erwerbstätigkeit etc. gemacht. Wichtig: Kommt kein Fragebogen, sollte die Pflegeperson aktiv bei der Pflegekasse nachfragen!
- Änderungen mitteilen: Ändern sich die Pflegesituation, der Pflegeumfang oder die Erwerbstätigkeit, muss dies der Pflegekasse gemeldet werden.
Wo gibt es Beratung und Unterstützung?
Pflegekassen sind die ersten Ansprechpartner und beraten zu den Voraussetzungen und zum Verfahren. Außerdem bietet die deutsche Rentenversicherung Informationen und Beratung zur Auswirkung auf die Rente (kostenlose Servicenummer: 0800 1000 4800, Website: www.deutsche-rentenversicherung.de). Pflegestützpunkte und kommunale Beratungsstellen bieten oft umfassende Pflegeberatung.
Sie als Betriebs- und Personalräte sollten hier aktiv werden und über die möglichen Leistungen aufklären. Nutzen Sie dafür unseren fertigen Aushang.
Außerdem empfehlen wir Ihnen unser Seminarangebot rund um das Thema: Mutterschutz, Eltern- und Pflegezeit – Arbeitsrecht Teil 4.
Weitere Themen inkl. Musteraushang
Darf ich über mein Gehalt reden?
Das Maßregelungsverbot des Arbeitgebers
Änderungen beim Kinderkrankengeld 2024
Weiterarbeiten trotz Altersrente
Rechte schwerbehinderter Beschäftigter
Spezialwissen BR
Aktuelle Urteile
BAG stärkt Betriebsratswahlen: Einladung zur Wahlversammlung auch ohne Übersetzung zulässig
Fahrtzeit als Arbeitszeit?
Die wichtigsten Informationen für Arbeitnehmende als Aushang zum Download
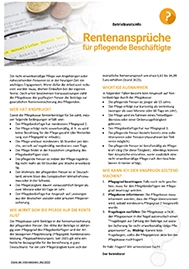
Diese Informationen sind für Sie als Musteraushang vorbereitet.
Dieser kann wie gewohnt heruntergeladen, nach Bedarf angepasst und ausgedruckt werden.
Download für Betriebsräte
Aktuelle Seminarempfehlungen:

Arbeitsrecht Teil 2: Arbeitsvertragliche Rechte und Pflichten
Urlaub, Teilzeit, Krankheit – was gilt wirklich? Ihr Update für rechtssichere Antworten im Gremium

Effektiver Schriftverkehr im Betriebsrat – klar und rechtssicher
Ihr souveräner Umgang mit Einladungen, Beschlüssen und Schreiben
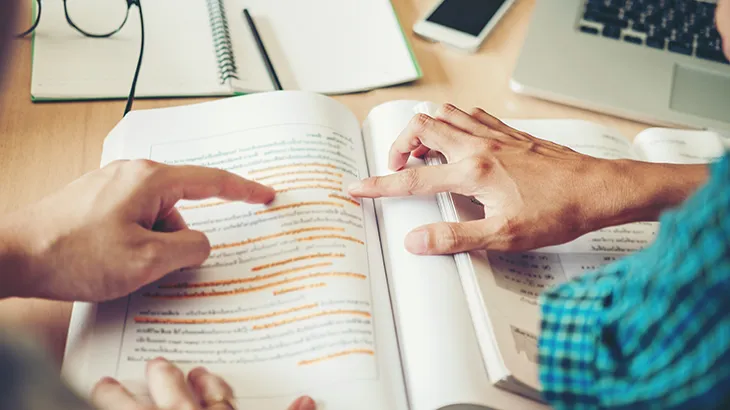
Betriebsverfassungsrecht Teil 1: Grundlagen der Betriebsratsarbeit
Ihr erfolgreicher Start in die Betriebsratsarbeit – rechtssicher, kompetent und engagiert




